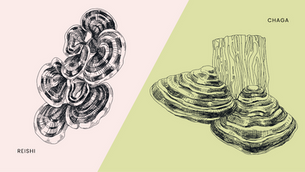Verwechslungsgefahr: Diese Pilzpaare müssen Sie kennen
- Lukas Steiner | Expert für Naturheilkunde

- 12. Nov. 2024
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 16. Dez. 2024
Die Pilzsuche gehört zu den schönsten Naturerlebnissen – doch sie erfordert fundiertes Wissen und größte Sorgfalt. Als langjähriger Pilzsachverständiger und Leiter der regionalen Pilzberatungsstelle erlebe ich jedes Jahr aufs Neue, wie schnell selbst erfahrene Sammler gefährliche Verwechslungsgefahren begehen können. Dieser Artikel könnte der wichtigste sein, den Sie je über Pilze lesen – denn er kann Leben retten.

Quelle: Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 701-8; DOI: 10.3238/arztebl.2020.0701
Warum Verwechslungen so gefährlich sind
Der Tod sitzt manchmal buchstäblich zwischen dem Champignonim Detail. Ein übersehener Ring am Stiel, eine nicht beachtete Manschette oder eine falsche Lamellenfarbe können über Leben und Tod entscheiden. Der Knollenblätterpilz etwa enthält Giftstoffe, die bereits in einem einzigen Pilz tödlich sein können. Das Tückische: Die ersten Symptome zeigen sich oft erst, wenn die Organe bereits schwer geschädigt sind.
Die Verwechslungsgefahr bei den kritischsten Pilzarten
Champignon und Knollenblätterpilz – eine potenziell tödliche Verwechslung

Der Weiße Knollenblätterpilz ist der gefährlichste Pilz unserer Wälder. Seine Verwechslung mit dem Wiesen-Champignon endet nicht selten tödlich. Die Unterscheidung ist jedoch mit der nötigen Sorgfalt möglich:
Der Champignon zeigt von Anfang an rosa bis später schokoladenbraune Lamellen. Seine Lamellen sind nie weiß! Der charakteristische Anisgeruch und der braune Schuppenring am Stiel sind weitere wichtige Merkmale. Er wächst typischerweise auf Wiesen und Weiden.
Der Knollenblätterpilz hingegen behält zeitlebens schneeweiße Lamellen. Er besitzt eine deutliche Knolle am Stielgrund und eine sackartige Hülle (Volva). Sein Geruch ist eher neutral bis leicht kartoffelartig. Seinen natürlichen Lebensraum findet er in Laub- und Mischwäldern, besonders unter Eichen.
Pfifferling und Falscher Pfifferling – der häufige Irrtum

Eine weniger gefährliche, aber häufige Verwechslung betrifft den beliebten Pfifferling. Der echte Pfifferling besitzt keine echten Lamellen, sondern herablaufende, gabelförmig verzweigte Leisten. Seine Farbe erinnert an frisches Eigelb, und beim Schneiden zeigt sich ein weißliches Fleisch.
Der Falsche Pfifferling wirkt dagegen orangerot, hat echte, dünnere Lamellen und orangefarbenes Fleisch. Zum Glück ist er nicht giftig, aber sein wässriger Geschmack enttäuscht kulinarisch. Er wächst oft in großen Gruppen, während der echte Pfifferling meist einzeln oder in kleinen Gruppen vorkommt.
Steinpilz und Gallenröhrling – wenn der Bitterstoff den Tag verdirbt

Eine häufige und ärgerliche Verwechslung passiert zwischen dem beliebten Steinpilz und dem Gallenröhrling. Zwar ist der Gallenröhrling nicht lebensbedrohlich giftig, kann aber durch seine extreme Bitterkeit ganze Pilzgerichte ungenießbar machen und Magen-Darm-Beschwerden verursachen.
Der echte Steinpilz besticht durch sein weißes, unveränderliches Fleisch und sein charakteristisches Netz am oberen Stielbereich. Die Röhren sind in der Jugend weißlich und werden später olivgrün. Der Hut ist meist braun und erinnert an eine frisch gebackene Brezel. Der Geschmack ist mild und nussig.
Der Gallenröhrling sieht dem Steinpilz täuschend ähnlich, hat aber einige entscheidende Unterscheidungsmerkmale:
Die Röhren sind bereits in der Jugend rosa gefärbt
Das Stielnetz ist meist dunkler und gröber
Bei Druck verfärbt sich das Fleisch oft rötlich
Der wichtigste Test: Eine winzige Geschmacksprobe (nicht schlucken!) zeigt einen deutlich bitteren Geschmack
Beide Pilze wachsen in ähnlichen Lebensräumen, vorwiegend in Laub- und Nadelwäldern. Der Steinpilz geht dabei bevorzugt Partnerschaften mit Fichten und Eichen ein.
Ein kleiner Trost: Selbst wenn ein Gallenröhrling übersehen wird – eine Mahlzeit ist zwar verdorben, aber ernsthafte gesundheitliche Folgen sind nicht zu befürchten. Dennoch können die ausgelösten Magen-Darm-Beschwerden sehr unangenehm sein.
Die goldenen Regeln der Pilzbestimmung
Die sichere Bestimmung eines Pilzes gleicht einer kriminalistischen Untersuchung – jedes Detail zählt:
Betrachten Sie immer den ganzen Pilz. Graben Sie ihn vorsichtig aus, um die Stielbasis zu sehen. Viele giftige Arten verbergen wichtige Merkmale im Boden.
Untersuchen Sie mehrere Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien. Manche Merkmale zeigen sich erst bei älteren Pilzen.
Achten Sie auf den Standort. Viele Pilze gehen feste Partnerschaften mit bestimmten Bäumen ein.
Das Sporenpulver kann entscheidend sein. Legen Sie den Pilzhut über Nacht auf weißes und dunkles Papier, um die Sporenfarbe zu bestimmen.
Sicherheit geht vor – immer und überall
Die moderne Technologie macht die Pilzbestimmung nicht unbedingt einfacher. Pilz-Apps können eine erste Orientierung geben, sind aber nie ein Ersatz für Expertenwissen. Zu viele Faktoren – Geruch, feine Strukturen, Standort – lassen sich nicht über ein Foto erfassen.
Nutzen Sie die Expertise von Pilzberatern. In der Pilzsaison bieten viele Gemeinden kostenlose Beratungen an. Als Pilzberater erlebe ich oft, wie dankbar Menschen sind, wenn wir ihnen einen giftigen Pilz aus dem Korb sortieren können.
Der wichtigste Rat zum Schluss: Essen Sie nur Pilze, die Sie hundertprozentig sicher bestimmen können. Im Zweifelsfall gilt immer: stehen lassen! Kein noch so leckerer Pilz ist das Risiko einer Vergiftung wert.
Ihre Sicherheits-Checkliste
Bevor Sie einen Pilz in den Korb legen:
Sind alle typischen Merkmale vorhanden und geprüft?
Passt der Standort zur vermuteten Art?
Haben Sie den kompletten Pilz ausgegraben?
Stimmen Geruch und Färbung?
Sind Sie absolut sicher bei der Bestimmung?
Werden Sie Mitglied in einem Pilzverein. Der Austausch mit erfahrenen Sammlern und die gemeinsamen Exkursionen sind die beste Schule. Das Pilzesammeln ist eine wunderbare Beschäftigung – aber nur mit dem nötigen Respekt und Wissen wird es zum sicheren Vergnügen.
Ein letztes Wort
Als Pilzberater erlebe ich oft, wie Menschen ihr Sammelverhalten nach einem Beratungsgespräch grundlegend ändern. Dieser neue Respekt vor der Komplexität der Pilzbestimmung ist genau die richtige Einstellung. Pilze zu sammeln bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für andere, die von unseren Sammlungen essen werden.